Index
E|Form – Dreistufig, automatisiertes Endformen von Flachleiterspulen im Blechpaket

Ein wesentlicher Ansatz im Projekt E|Form ist es, die Fertigung von Elektromotoren mit Formspulentechnik zu automatisieren. Im Rahmen der Produktion von Antrieben für den schienengebundenen Verkehr sind auf Grund von geringen Stückzahlen viele händisch durchgeführte Arbeitsschritte gängiger Standard. Durch den Einsatz von Sensorik und Aktorik sowie speziell auf den Montageprozess ausgelegten Vorrichtungen soll ein insgesamt dreistufiges Montageumfeld geschaffen werden. Mit dessen Hilfe ist eine signifikante Reduktion der Montagezeit möglich, da die Hauptmontage der vorgewickelten Spulen nicht sequentiell und händisch, sondern allumfassend automatisiert erfolgt.
FAR – Entwicklung neuartiger Fertigungsverfahren für einen hocheffizienten Antrieb in der Radnabe

Das Forschungsprojekt FAR adressiert die Entwicklung von hochautomatisierten und serientauglichen Fertigungsprozessen zur Herstellung von Radnabenmotoren für elektrische Kfz und Nfz im Hinblick auf den Großserieneinsatz. Die Verbundpartner DeepDrive GmbH und der Lehrstuhl FAPS setzen hierzu auf die patentierte Motortechnologie von DeepDrive, um anhand dessen die einsetzbaren Fertigungsprozesse eines Radnabenantriebs zu untersuchen, zu bewerten, weiterzuentwickeln sowie auf Serienreife hin zu optimieren. Die hohe Effizienz der Motortechnologie von DeepDrive ermöglicht bei Elektrofahrzeugen eine Reichweitensteigerung von bis zu 20 % gegenüber heute verwendeten, zentralen Antriebslösungen. Gleichzeitig soll durch die ressourceneffiziente Bauweise und den Wegfall eines Getriebes erstmals erreicht werden, Radnabenantriebe kostengünstiger darzustellen als zentrale Antriebslösungen. Die entwickelten Fertigungsprozesse sind sowohl für Hochvolt- als auch Niedervoltanwendungen anwendbar und sollen zur Schaffung eines neuen Benchmarks in der Radnabentechnologie beitragen.
MuViS – Hybride KI zur lernfähigen, dateneffizienten und erklärbaren Multi-View-Sichtprüfung von variantenreichen Montagebaugruppen
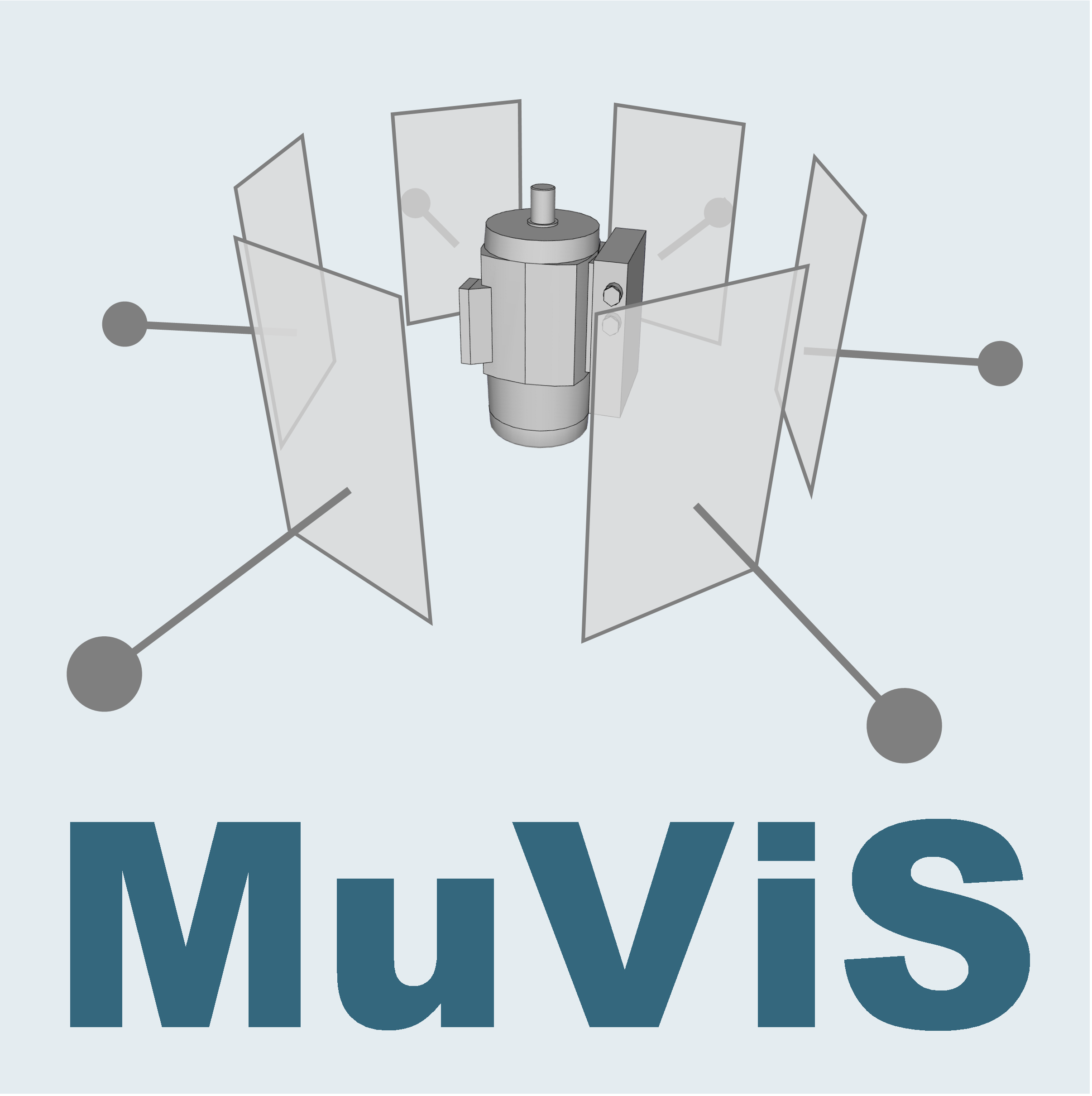
Obwohl das Anwendungsspektrum der Bildverarbeitung seit Jahren wächst, ist bis heute nur ein Teil der industriellen Sichtprüfungsaufgaben automatisiert. Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) bergen das Potential, künftig auch schwierige, bislang manuell durchgeführte Sichtprüfungsaufgaben zu automatisieren. Da klassische Deep-Learning-(DL)-Verfahren eine große Menge an Trainingsdaten erfordern, sind sie bei Prüfobjekten mit hoher Varianz und kleinen Losgrößen kaum anwendbar. Ferner sind gängige DL-Architekturen auf die Auswertung einzelner Bildperspektiven beschränkt, aufgrund ihres Blackbox-Charakters nur bedingt erklärbar und ohne Möglichkeit, bestehendes Fakten- und Regelwissen einzubeziehen. Demnach ist es das Ziel des vorliegenden Forschungsprojekts, den genannten Herausforderungen durch die Entwicklung einer hybriden, dateneffizienten KI-Lösung zu begegnen, welche es ermöglichen soll, künftig auch Montagebaugruppen mit hoher Variantenvielfalt automatisch zu inspizieren.
ProKI-Nürnberg – Demonstrations- und Transferzentrum zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Fügetechnik als Teil des bundesweiten ProKI-Netzes

ProKI-Nürnberg ist eines von insgesamt acht deutschlandweit agierenden ProKI-Zentren des ProKI-Netzes. Das ProKI-Netz dient Unternehmen, insb. KMU, als zentrale Anlaufstelle für die Weiterbildung und Beratung rund um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Produktion. Der Fokus des Nürnberger ProKI-Zentrums liegt auf KI-Anwendungsfällen in der Fügetechnik, insbesondere im Bereich der Elektronikproduktion und des Elektromaschinenbaus.
Weitere Infos zu aktuellen Veranstaltungen und Ansprechpartnern finden sich unter: www.proki-nuernberg.de
transform_EMN – Transformation der Fahrzeug- und Zulieferindustrie in der Metropolregion Nürnberg

Rund 100.000 Beschäftigte in der Europäischen Metropolregion Nürnberg (EMN) arbeiten bei Zulieferunternehmen der Fahrzeugindustrie. Viele der Arbeitsplätze sind vom Verbrenner abhängig und durch die Transformation der Branche gefährdet. Das Großprojekt transform_EMN mit einem Volumen von rund 6,6 Millionen Euro unterstützt Unternehmen unter anderem bei der Entwicklung neuer Geschäftsideen und dem notwendigen Technologietransfer.
Der Lehrstuhl FAPS übernimmt den Aufbau und Betrieb der Innovationsplattform „Transformationsgerechte Produktion – Sustainable and Digital Manufacturing“. Teilnehmende KMUs der Automotive- und Zulieferindustrie erhalten hierbei die Möglichkeit, Technologien für eine digitale, energieeffiziente und klimaschonende Produktion zu testen, diese gemeinsam mit WissenschaftlerInnen der beteiligten Forschungseinrichtung weiterzuentwickeln sowie gewonnene Produktionsfähigkeiten zu demonstrieren. Aus diesen Erfahrungen heraus entwickelt und verbreitet der Lehrstuhl vielfältige Qualifizierungsangebote und Beratungsmaßnahmen.
Im Kontext der Digitalisierung der Produktion erarbeitet der Lehrstuhl bedarfsgerechte Lösungen für die lokale Zulieferindustrie. Damit ein kosteneffizienter und niedrigschwelliger Einstieg gelingen kann, soll im besonderen Maße die Nutzung von Open-Source-Software und moderner Cloud-Technologien forciert werden. Inhaltlicher Fokus bildet einerseits die Ableitung geeigneter Datenmodelle, die Untersuchung modernster Kommunikationstechnologien sowie die Demonstration von Methoden der künstlichen Intelligenz. Im Rahmen der systematischen Intelligenzsteigerung erfolgt die Demonstration der gewonnenen Erkenntnisse an innovativen Fertigungsanlagen in der Praxis.
Die zweite Themenvertiefung ist die Umstellung auf eine nachhaltige und CO2-neutrale Produktion. Dabei spielt die Auslegung nachhaltiger und intelligenter Energieverteilungsarchitekturen für Produktionsstandorte sowie die Integration dezentraler, regenerativer Erzeuger und Speicher sowohl aus Hardwareperspektive als auch die intelligente Kopplung und Überführung in ein Industrie 4.0-gerechtes Energiemanagement eine wesentliche Rolle. Als besonderes Lösungskonzept sind effiziente Gleichstromnetze zu nennen.

REEPRODUCE – Recycling von Permanentmagneten aus End-of-Life Produkten

Steigende Preise und Verfügbarkeitsunsicherheiten von Industrierohstoffen gefährden die Produktion innovativer Produkte und damit die Klimaziele der Europäischen Union. Von einer besonders großen Bedeutung sind dabei die schwer ersetzbaren sogenannten Seltenen Erden (Rare Earth Elements, REE), welche beispielsweise in der Produktion von Halbleitern oder Permanentmagneten und damit unter anderem in der Fertigung von Elektromotoren eingesetzt werden. Der Import dieser Metalle erfolgt überwiegend aus der VR China, was angesichts vergangener und aktueller Exportrestriktionen ein Risiko für die Versorgungssicherheit der europäischen Industrie darstellt. Die Reduktion der Importabhängigkeit im Bereich der Seltenen Erden, beispielsweise durch die Schaffung eines innereuropäischen Recyclingkreislaufs, ist somit im großen Interesse der Europäischen Union. Forschungsprojekte haben bereits gezeigt, dass ein geschlossener Recyclingprozess im Bereich der auf Seltenen Erden basierenden Dauermagnete prinzipiell umsetzbar ist.
Im Rahmen des durch die EU geförderten Forschungsprojekts REEPRODUCE soll durch 15 Forschungs- und Technologieeinrichtungen aus acht europäischen Ländern unter der Beteiligung des FAPS die wirtschaftliche Separierung von hartmagnetischen Bestandteilen ausgehend von verschiedenen End-of-Life (EoL) Produkten ermöglicht werden. Das mit einer Summe von 10,1 Millionen Euro geförderte Projekt aus dem Horizon Europe Programm, welches von SINTEF (Norwegen) geleitet wird, soll weiterhin die Einsatzfähigkeit von Recyclingtechniken in einem industriellen Maßstab zeigen und den umwelttechnischen Einfluss des Recyclings von REE untersuchen. Damit wird die gesamte Wertschöpfungskette ausgehend von EoL-Produkten bis zur Herstellung neuer Permanentmagnete abgedeckt. Das Projekt trägt dazu bei die ambitionierten Klimaziele der EU bis 2030 erreichen, während die Konkurrenzfähigkeit des europäischen Industrierohstoffsektors gestärkt wird.
ProDRIMo – Flexible Montage formlabiler Draht- und Isolationsmaterialien durch KI-gestützte Robotersysteme in der Produktion elektrischer Maschinen

Unter Einsatz fortgeschrittener Sensorik, Aktorik und Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) werden Roboter immer mehr zu lernenden Systemen, die mit dem Menschen interagieren, Entscheidungen treffen und immer komplexer werdende Aufgaben übernehmen. Infolgedessen eröffnen sich neue Einsatzpotentiale, die über die klassischen Anwendungsgebiete von Industrierobotern hinausgehen. Gerade die Herstellung von elektrischen Maschinen, egal ob Elektromotoren, Generatoren oder Transformatoren, ist aufgrund formlabiler Materialien und Bauteile nach wie vor von manuellen Montagetätigkeiten geprägt. Aufgrund des hohen hiesigen Lohnniveaus werden Prozesse, die die Handhabung formlabiler Isolations- und Drahtmaterialien bedingen, zusehends ins Ausland verlegt. Dieser Trend ist insbesondere bei mittelständischen Produzenten, die einen Großteil ihres Umsatzes mit der Herstellung kundenspezifischer Maschinen in kleinen bis mittleren Stückzahlen erzielen, feststellbar. Ziel des Forschungsprojekts ProDRIMo ist es daher, innovative Systemlösungen zur roboterbasierten Montage von formlabilen Isolations- und Drahtmaterialien zu erforschen und dadurch zur Automatisierung bislang manueller Prozesse in der Herstellung elektrischer Maschinen beizutragen. Die maßgeblichen technologischen Befähiger stellen neuartige taktile und optische Sensoren, performante Hardware, mechatronische Endeffektoren sowie KI-gestützte Methoden zur Perzeption und Regelung dar. Stellvertretend für sämtliche Hersteller elektrischer Maschinen werden die erforschten Systemmodule anhand zweier konkreter Anwendungsbeispiele erprobt und perspektivisch auch auf weitere Bereiche der Elektroindustrie transferiert.
OptiWiRE – Optimierte Wickel- und Montageverfahren für recyclinggerechte Elektromotoren
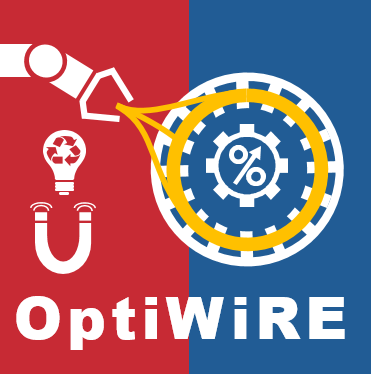

Die Ziele des Vorhabens OptiWiRE, mit den Verbundpartnern ElringKlinger AG und dem Lehrstuhl FAPS, sind eine Verbesserung der Prozesskette bei der Herstellung von Elektromotoren, in Bezug auf der in der Automobilbranche sehr hohen Anforderungen an Taktzeit, Qualität und Flexibilität der Fertigung. Ein wesentliches Ziel, zu dem dieses Projekt beitragen soll, ist die Übergang von der Prototypen-Fertigung zur Vorserienproduktion. Weiter zielt das Vorhaben auf eine Effizienzsteigerung der Elektromotoren ab um eine höhere Lebensdauer der Motoren zu erreichen und um auch den Energieverbrauch von E-Fahrzeugen und die damit verbundene Reichweite zu erhöhen. Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit kritische Fertigungsprozessschritten wurden bereits in Voruntersuchungen identifiziert. Dabei konnten wesentliche Optimierungspotentiale bei der Wicklungsherstellung am Stator und bei der Magnetmontage im Rotor festgestellt werden. Für diese beiden Prozessschritte sollen im Rahmen des Projektes Verbesserungen hinsichtlich des Produktes E-Maschine und der Produktion durch die Adaption neuer Verfahren erzielt werden.
Innerhalb des Gesamtvorhabens OptiWiRE wird im Teilvorhaben “füllgradoptimierte, automatisierte Statormontage von verteilten Einzugswicklungen” vom Lehrstuhl FAPS der FAU die Prozesskette der Statorproduktion ausgehend vom Statorblechpaket bis zur Kontaktierung der Stern- und Phasenverbinder betrachtet. Auf Grund von höheren Automatisierungspotentialen soll im Bereich der Stator-Fertigung das Einziehwickelverfahren für den industriellen Einsatz mit dem Ziel weiterentwickelt werden, flexibel auf Varianten- und Stückzahländerungen reagieren zu können. Ein wesentlicher Ansatz ist es dabei, den Draht definierter abzulegen, um den Kupferfüllgrad im Stator zu erhöhen sowie die Taktzeit des Prozesses zu verringern. Dies soll durch die flexible Automatisierung der dem Wickeln vor- und nachgelagerten Prozesse realisiert werden. So sollen insbesondere bei der Handhabung und Prozessführung von losen Leiterenden und Drahtbündeln deutliche Verbesserungen erreicht werden, um höchste Qualität und kürzeste Taktzeiten bei steigenden Produktionsmengen realisieren zu können.
Im Teilvorhaben “Prozessentwicklung beim Rotorbau – Fixierung der Magnete” untersucht die ElringKlinger AG die Optimierung der Rotorbaugruppe des im Projekt verwendeten Elektromotors. Das Verkleben der Magnete stellt den Stand der Technik im Bereich der Magnetmontage dar. Dies hat den Umgang mit Chemikalien, langen Prozesszeiten und aufwendigen Temperiervorgängen zur Folge. Durch die stoffschlüssige Verbindung von Magnet, Klebstoff und Rotorpaket lassen sich diese Komponenten nach der Lebensdauer des Motors im Recyclingprozess kaum noch voneinander trennen. Beim Versuch die Seltenen-Erde-Magnete aus dem Rotorpaket zu lösen zerbrechen diese. Eine sortenreine Trennung von Magneten und Blechmaterial ist ebenfalls durch die stoffschlüssige Verbindung des Klebstoffes erschwert. Rückstände des Klebstoffes bleiben an den Bauteilen haften. Diesen Herausforderungen stellt sich die ElringKlinger AG durch Entwicklungen von innovativen Magnetfixierungsstrategien.
TELEM – Technologische Befähigung hybrid-elektrischer Antriebssysteme für bemannte Fluggeräte durch die Erforschung luftfahrtgerechter Elektrischer Maschinen sowie deren Integration in Antriebssysteme

Mit der europäischen Zukunftsvision Flightpath 2050, die die EU-Kommission sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie gemeinsam erarbeitet haben, sollen die Emissionen in der europäischen Luftfahrt bis 2050 deutlich reduziert werden. Dieses Ziel kann nur durch den Einsatz von elektrischen Antrieben im Luftfahrtbereich erreicht werden. Diese unterscheiden sich maßgeblich gegenüber herkömmlichen elektrischen Antrieben für industrielle und automobile Anwendungen in Bezug auf Leistungsdichte und Effizienz.
Das Forschungsprojekt TELEM wird im Rahmen des Luftfahrtforschungsprogramms VI-1 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert und im Verbund mit industriellen sowie wissenschaftlichen Partnern durchgeführt. Der Lehrstuhl FAPS beteiligt sich in diesem Projekt in den kommenden drei Jahren mit der Erforschung von Produktions- und Prüfverfahren für die Herstellung von luftfahrtgerechten elektrischen Antrieben. Hierbei liegt der Fokus auf Antrieben mit einer Leistung von bis zu 2.000 kW. Hierfür existieren zum heutigen Stand der Technik keine Fertigungsverfahren, die eine Erfüllung der luftfahrtspezifischen Anforderungen ermöglichen. Neben der reproduzierbaren und beschädigungsfreien Verarbeitung der Hochleistungswerkstoffe, muss eine durchgängige Prozesskontrolle sichergestellt werden, so dass die Robustheit, die Nachverfolgbarkeit und die Dokumentierbarkeit der neuen Prozesse gewährleistet ist. Nur so werden die hohen Qualitätsstandards eingehalten, so dass es im Betrieb zu keinen Ausfällen durch fertigungsbedingte Defekte der Komponenten kommt.
ExApeMo – Expertensystem zur Analyse permanenterregter Motoren
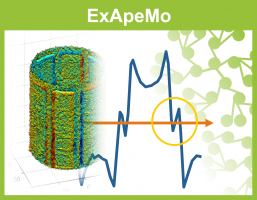
Die gegenwärtige Entwicklung elektrischer Antriebe fokussiert neben der Senkung der Herstellungs- und Fehlerkosten auch immer die Steigerung der Effizienz und Leistungsdichte. Letztere wird vor allem durch den Einsatz permanenterregter Maschinen erzielt, da diese auf Grund der Bauart ohne elektrische Erzeugung des Läufermagnetfeldes auskommen und somit die ohmschen Verluste wegfallen, was potentiell einen höheren Wirkungsgrad bedeutet. Einen erheblichen Einfluss auf die Qualität eines permanenterregten Synchronmotors hat das Luftspaltfeld, welches durch Rotor und Stator aufgebaut wird. Die Auswirkungen der Magnetfelder auf die wesentlichen Zielgrößen eines Antriebes im Hinblick auf optimale Leistungsdichte, Reduzierung von Rastmomenten, Vermeidung von Vibrationen und Verringerung von Lärmemissionen können im Herstellungsprozess jedoch nur begrenzt betrachtet werden.
Bereits bestehende Messsysteme zur Charakterisierung der magnetischen Komponenten erlauben die Prüfung des magnetischen Streufeldes im Rahmen von Entwicklungsprozessen. Die Bedienung dieser Messgeräte setzt jedoch eine besondere Expertise im Fachgebiet des Elektromaschinenbaus voraus und die Bewertung der Messergebnisse erfordert tiefgehende Kenntnisse im Bereich der Motorauslegung. Die Mess- und Auswertungstools bieten außerdem keine Möglichkeiten, Geometriebeschreibungen und Simulationsdaten zu importieren und in die Interpretation der erhobenen Messdaten einzubeziehen.
Im Rahmen des Projektes ExApeMo werden fehlende technische Bindeglieder zwischen Magnetfeldsimulation und Magnetfeldmessung von permanenterregten Motoren erarbeitet und eine Software zur Integration von Messdaten und zur Identifikation von Abweichungsursachen konzipiert und umgesetzt.
